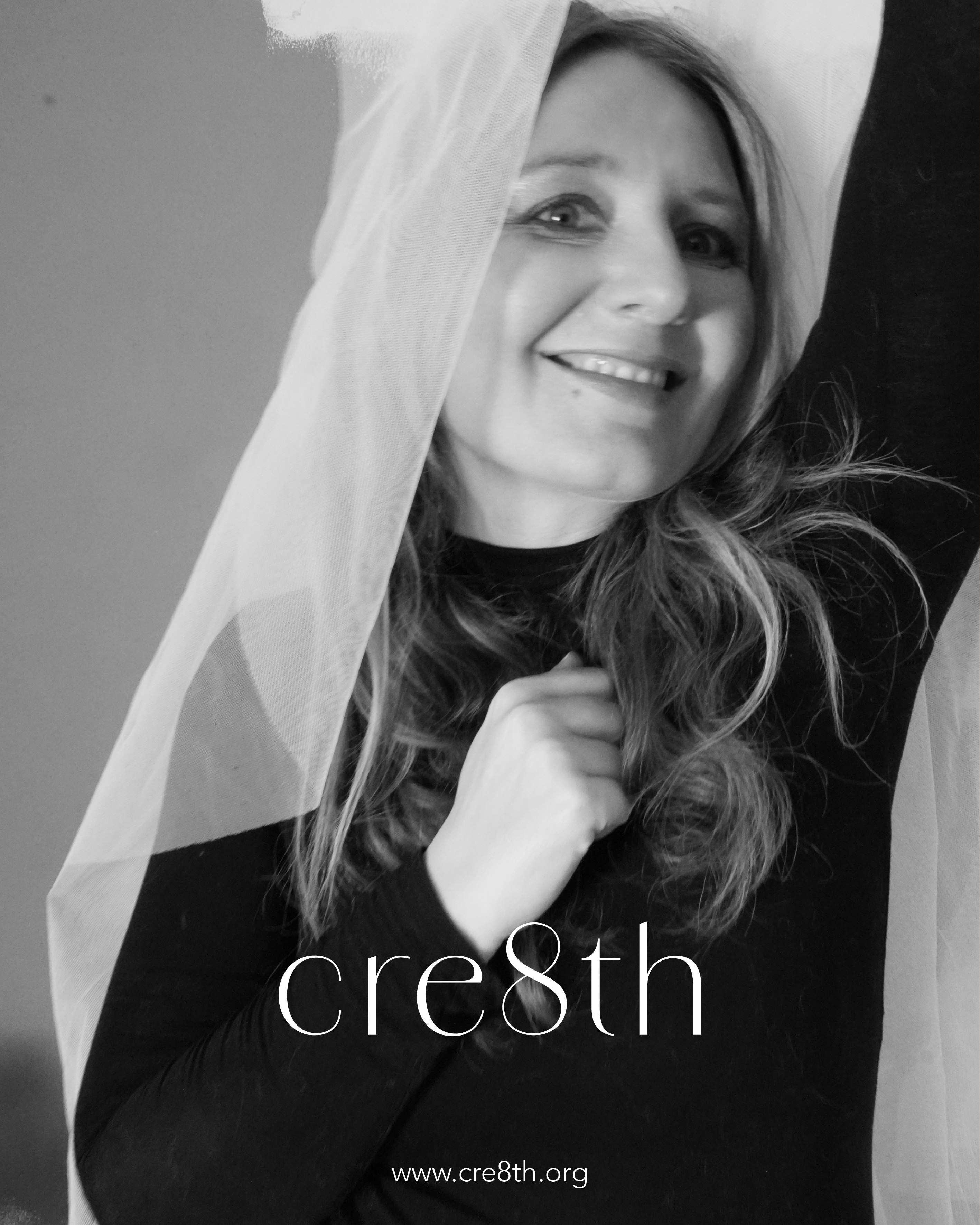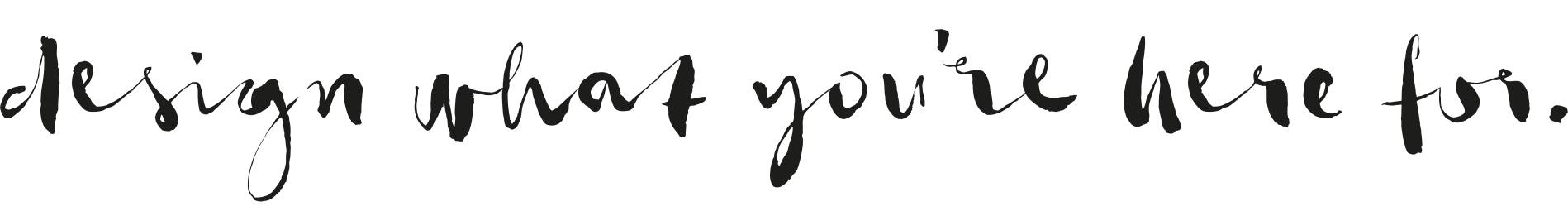Immer wieder werde ich gefragt, was genau ein Social Business ist. Tatsächlich führen viele meiner Kunden bereits ein solches, ohne es zu wissen oder als solches zu definieren. Oft bezeichne ich ihre Unternehmen lieber als Purpose Business, denn in beiden Konzepten gibt es große Überschneidungen. Wer mich kennt, weiß, wie zentral das Finden der eigenen Bestimmung in meiner Arbeit ist. Es geht immer um das „Warum“ – die Mission, den inneren Antrieb, dieses tief empfundene „To-Do-Gefühl“. Meist ist es seit Kindheitstagen spürbar und wird zu einer klaren Richtung im Leben: Warum bist du hier, und was soll von dir bleiben, wenn du längst nicht mehr da bist?
Obwohl Social Business auf den ersten Blick ein rationales, wirtschaftliches und soziales Konzept ist, trägt es gleichzeitig eine spirituelle Tiefe in sich. Viele meiner Kunden starten nicht mit dem Ziel, ein Sozialunternehmen zu gründen. Doch während unserer gemeinsamen Arbeit, etwa im Rahmen von INCARNATION, wird klar: Wenn Bewusstsein und Authentizität zum Fundament eines Unternehmens werden, führt dies fast zwangsläufig zu einem Social oder Purpose Business. Alles andere macht in einer Zeit wie der heutigen – geprägt von tiefem Bewusstsein und einem neuen Verständnis von Werten – schlicht keinen Sinn.
Die Definition von Social und Purpose Business
Ein Social Business ist ein Unternehmen, das primär soziale oder ökologische Herausforderungen lösen möchte, während es wirtschaftlich nachhaltig bleibt. Gewinne werden meist reinvestiert, um die Mission weiter zu fördern.
Ein Purpose Business geht darüber hinaus. Der gesamte Unternehmenszweck – der Purpose – wird an einer übergeordneten Mission ausgerichtet. Hier geht es nicht nur darum, ein bestimmtes Problem zu lösen, sondern darum, dass alle Geschäftsaktivitäten von einem größeren Sinn getragen werden.


Die spirituelle Dimension eines Social Business
Ein Social Business ist weit mehr als nur ein Unternehmen. Es repräsentiert ein tiefes Bewusstsein und den Wunsch, mit unternehmerischem Handeln Transformation zu bewirken.
Das Prinzip des Gebens und Empfangens
Social Businesses basieren oft auf der universellen Gesetzmäßigkeit von Karma. Gute Taten – wie das Lösen sozialer Probleme oder das Schaffen von Gemeinschaften – erzeugen positive Energien, die letztlich allen Beteiligten zugutekommen. Das Geben wird zum Empfang, nicht nur materiell, sondern auch auf energetischer Ebene.
Berufung als Fundament
Die Arbeit von Social Entrepreneurs ist selten rein strategisch – sie entsteht aus einem inneren Ruf, einer tief empfundenen Bestimmung. Ein Social Business ist daher oft der Ausdruck der Talente, Erfahrungen und Werte eines Menschen, der durch sein Tun einen Beitrag leisten möchte.
Materialisierung von Werten
Ein Social Business ist ein spiritueller Akt der Schöpfung. Es geht nicht nur um das Lösen äußerer Herausforderungen, sondern um die Manifestation eines inneren Wertesystems. Durch das Unternehmen wird etwas geboren, das größer ist als die Person selbst und das über das eigene Dasein hinaus Bestand hat.
Social vs. Purpose Business
Fokus und Ausrichtung
Social Business: Der Fokus liegt auf der Lösung eines klar definierten Problems, meist sozialer oder ökologischer Natur.
Purpose Business: Der Purpose fließt in jede Entscheidung ein und wird zur Grundlage aller Geschäftsaktivitäten.
Umgang mit Gewinnen
Social Business: Gewinne werden reinvestiert, um die Mission voranzutreiben.
Purpose Business: Gewinne können verteilt werden, solange sie mit der Mission im Einklang stehen.
Strategische Perspektive
Social Business: Konzentriert sich auf konkrete Projekte zur Lösung des Problems.
Purpose Business: Verfolgt einen umfassenderen Ansatz, der alle Geschäftsbereiche umfasst.
Gemeinsamkeiten
Beide Unternehmensarten haben dasselbe Fundament:
Mission als Antrieb
Sowohl Social Businesses als auch Purpose Businesses richten ihre Aktivitäten konsequent auf ihre übergeordnete Mission aus.
Nachhaltigkeit und Verantwortung
Nachhaltigkeit ist keine Option, sondern ein Kernprinzip.
Langfristiger Einfluss
Das Ziel ist nicht kurzfristiger Erfolg, sondern eine dauerhafte positive Veränderung – für die Gesellschaft, die Umwelt und die Welt an sich.


Ein Blick auf die spirituelle Wirksamkeit
Social Businesses repräsentieren ein hohes Maß an Eigenverantwortung und spiritueller Reife. Während klassische Hilfsorganisationen oft von Spenden oder staatlicher Unterstützung abhängig sind, basieren Social Businesses auf Selbstwirksamkeit. Sie schaffen aus sich selbst heraus Werte, indem sie innovative und nachhaltige Lösungen umsetzen.
Ein Social Business wird damit zu einem energetischen Feld, das nicht nur sichtbare, sondern auch unsichtbare Wirkungen entfaltet. Es verbindet Menschen mit gemeinsamen Werten und transformiert die Welt auf allen Ebenen – materiell, emotional und spirituell.
Beispiele für Social Businesses
Inspirierende Beispiele für Social Businesses gibt es weltweit:
Grameen Bank
Mikrokredite für Menschen in Armut.
TOMS Shoes
Das „One for One“-Modell, bei dem für jedes verkaufte Paar Schuhe ein weiteres gespendet wird.
Ecosia
Die Suchmaschine, die mit ihren Einnahmen weltweit Bäume pflanzt.
einhorn
Nachhaltige Produkte, die das Unternehmen unabhängig von Investoren machen.
Warum Social Businesses wichtiger denn je sind
In einer Welt, die von Krisen, Wandel und wachsenden Herausforderungen geprägt ist, sind Social Businesses ein kraftvoller Beweis dafür, dass wirtschaftlicher Erfolg und moralische Integrität kein Widerspruch sind.
Sie schaffen eine neue Form von Wirtschaft, die nicht nur auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, sondern auf Nachhaltigkeit, Verantwortung und Sinn. Ein Social Business ist nicht nur ein Unternehmen – es ist ein bewusstes Schöpfungswerk, das den kollektiven Wandel aktiv vorantreibt.